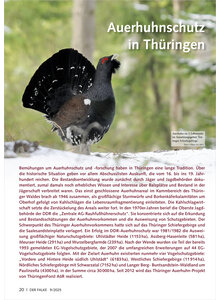Siegfried Klaus, Ralf Siano, Christoph Unger
Auerhuhnschutz in Thüringen
Auerhuhnschutz in Thüringen
Artikelnummer: FA250904
Bemühungen um Auerhuhnschutz und -forschung haben in Thüringen eine lange Tradition. Über die historische Situation geben vor allem Abschusslisten Auskunft, die vom 16. bis ins 19. Jahrhundert reichen. Die Bestandsentwicklung wurde zunächst durch Jäger und Jagdbehörden dokumentiert, zumal damals noch erhebliches Wissen und Interesse über Balzplätze und Bestand in der Jägerschaft verbreitet waren. Das einst geschlossene Auerhuhnareal im Kammbereich des Thüringer Waldes brach ab 1946 zusammen, als großflächige Sturmwürfe und Borkenkäferkalamitäten um Oberhof gefolgt von Kahlschlägen die Lebensraumfragmentierung einleiteten. Die Kahlschlagwirtschaft setzte die Zerstückelung des Areals weiter fort. In den 1970er-Jahren berief die Oberste Jagdbehörde der DDR die "Zentrale AG-Rauhfußhühnerschutz". Sie konzentrierte sich auf die Erkundung und Bestandsschätzungen der Auerhuhnvorkommen und die Ausweisung von Schutzgebieten. Der Schwerpunkt des Thüringer Auerhuhnvorkommens hatte sich auf das Thüringer Schiefergebirge und die Saalesandsteinplatte verlagert. Ein Erfolg im DDR-Auerhuhnschutz war 1981/1982 die Ausweisung großflächiger Naturschutzgebiete: Uhlstädter Heide (1153 ha), Assberg-Hasenleite (581 ha), Meuraer Heide (291 ha) und Wurzelbergfarmde (239 ha). Nach der Wende wurden sie Teil der bereits 1993 gemeldeten EG-Vogelschutzgebiete, der 2007 die umfangreichen Erweiterungen auf 44 EGVogelschutzgebiete folgten. Mit der Zielart Auerhuhn existierten nunmehr vier Vogelschutzgebiete: "Vordere und Hintere Heide südlich Uhlstädt" (6183 ha), Westliches Schiefergebirge (11 914 ha), Nördliches Schiefergebirge mit Schwarzatal (7152 ha) und Langer Berg- Buntsandstein-Waldland um Paulinzella (4300 ha), in der Summe circa 30 000 ha. Seit 2012 wird das Thüringer Auerhuhn-Projekt von ThüringenForst AöR realisiert.Zurück